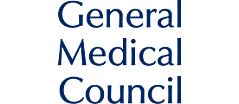Dyshidrotisches Ekzem

Medizinisch geprüft von
Dr. med. Ulrike ThiemeLetzte Änderung: 23 Jun 2022
Viele Menschen erkranken von Zeit zu Zeit an Ausschlägen oder anderen Hautveränderungen. Eine relativ häufige Hautkrankheit ist das sogenannte dyshidrotische Ekzem. Diese Unterform des Ekzems tritt bevorzugt an Händen und Füßen auf, kann stark jucken und betroffene Patienten im Alltag deutlich einschränken. Im folgenden Artikel finden Sie Informationen zur Entstehung des dyshidrotischen Ekzems, wie man diese Hauterkrankung erkennen kann und welche Möglichkeiten zur Behandlung und zur Vorbeugung existieren.

Kurzübersicht
Definition & Häufigkeit: Das dyshidrotische Ekzem ist eine Entzündungsreaktion der Haut, bei der sich pralle, stark juckende Bläschen oder Blasen an Händen und/oder Füßen bilden. Experten schätzen, dass pro Jahr 0,5 % der Bevölkerung an einem dyshidrotischen Ekzem erkranken.
Symptome: Typische Symptome des dyshidrotischen Ekzems sind kleine Bläschen und größere Blasen an Händen und Füßen, die von einem starken Juckreiz begleitet werden.
Ursachen: Mögliche Ursachen und Risikofaktoren sind Rauchen, Atopie (Neigung zu Überempfindlichkeitsreaktionen), reizende Stoffe und Kontaktallergene, Pilzinfektionen der Haut, Nickel oder Kobalt im Körper, exzessiver Gebrauch von Schutzhandschuhen, Stress und Hyperhidrose (krankhaftes Schwitzen). Häufig kann jedoch keine konkrete Ursache festgestellt werden.
Behandlung: Die Behandlung des dyshidrotischen Ekzems kann schwierig sein; in vielen Fällen tritt das Ekzem immer wieder auf. Zum Einsatz kommen vor allem Kortikosteroid-Cremes (veraltet: Cortison-Cremes) und Pflegesalben, aber auch die sogenannte PUVA-Therapie mit UV-Licht. In schweren Fällen müssen Kortikosteroide innerlich angewendet werden. Zudem sollten Betroffene Allgemeinmaßnahmen wie eine schonende Hautpflege beachten.
Was ist ein dyshidrotisches Ekzem?
Das dyshidrotische Ekzem ist eine spezielle Hautveränderung, die typischerweise an den Handinnenflächen, den Seiten der Finger sowie an den Fußsohlen auftritt. Geschätzt leiden pro Jahr 0,5 % der Bevölkerung an einem dyshidrotischen Ekzem, das auch als dyshidrotische Dermatitis oder dyshidrotisches Hand- und Fußekzem bezeichnet wird. Die genaue Entstehung des dyshidrotischen Ekzems ist noch nicht geklärt, allerdings deuten Forschungsergebnisse darauf hin, dass es sich um eine Art der allergischen Entzündungsreaktion handelt beziehungsweise durch Kontakt mit Reizstoffen ausgelöst werden kann. Das dyshidrotische Ekzem ist daher nicht ansteckend, sondern auf den betroffenen Patienten beschränkt.
Hauptsymptome des Ekzems sind prall gefüllte Blasen und Juckreiz an den betroffenen Stellen, die bei stärkerer mechanischer Belastung aufreißen können. Die Unterscheidung zu anderen Hauterkrankungen wird vor allem anhand des Aussehens des Ekzems, seiner Entstehung und der Verteilung am Körper getroffen.
Symptome und Ausprägungen
Das dyshidrotische Ekzem weist charakteristische Symptome auf. Es betrifft vor allem die Handinnenflächen, die Fußsohlen sowie die Zwischenräume der Finger und Zehen. Dort bilden sich ohne Vorwarnzeichen stark juckende Bläschen, die auch zu größeren Blasen heranreifen können. Die Bläschen sind prall mit Flüssigkeit gefüllt und können bei mechanischer Belastung aufreißen, zum Beispiel durch Kratzen.
Eine Rötung der Haut ist möglich, sie kann aber auch nur sehr dezent sein. Die Bläschenbildung tritt bei der Mehrheit symmetrisch an beiden Händen beziehungsweise Füßen auf, in 80 % der Fälle sind nur die Hände betroffen. Schmerzen oder Brennen beschreibt nur ein Teil der Patienten.
Die Bläschen heilen unbehandelt nach mehreren Wochen unter Bildung von groben Schuppen ab. Bei häufigem oder chronischem Auftreten verändert sich die Haut und verdickt sich (Lichenifikation), außerdem kann sie sich schälen oder aufreißen.
Das dyshidrotische Ekzem wird in mehrere Unterformen unterteilt. Neben dem normalen dyshidrotischen Ekzem mit den beschriebenen Symptomen existieren noch 2 Unterformen, die Dyshidrosis lamillosa sicca sowie das Pompholyx.
Dyshidrosis lamellosa sicca

Diese Unterform kann als leichtere chronische Variante des dyshidrotischen Ekzems angesehen werden. Die Bläschen trocknen dabei schneller ein ohne aufzureißen. Zurück bleiben runde, weißliche Vertiefungen in der Haut, die mit der Zeit abschuppen. Entzündungszeichen wie Rötung oder Schmerzen sind nur gering ausgeprägt oder fehlen sogar komplett. Die Dyshidrosis lamillosa sicca tritt in unregelmäßigen Abständen schubartig auf (chronisch-rezidivierender Verlauf).
Cheiropompholyx und Podopompholyx

Als Pompholyx wird ein besonders schweres dyshidrotisches Ekzem bezeichnet. Wenn ein Pompholyx an den Händen auftritt, nennt man es Cheiropompholyx, an den Füßen wird der Begriff Podopompholyx verwendet. Beim Pompholyx bilden sich bis zu mehrere Zentimeter große Blasen, die einreißen können. Außerdem können sich diese Blasen relativ leicht mit Krankheitserregern wie Bakterien infizieren. Diese Infektionen breiten sich unter Umständen in das Unterhautgewebe aus und müssen ärztlich behandelt werden.
Ursachen und Risikofaktoren
Meistens lässt sich im Einzelfall keine genaue Ursache für die Entstehung des dyshidrotischen Ekzems finden. Es gibt aber eine Reihe von äußeren und inneren Faktoren, von denen bekannt ist, dass sie den Ausbruch begünstigen können. Die frühere Vorstellung, dass dem dyshidrotischen Ekzem eine Störung der Schweißdrüsen zugrunde liegt, ist mittlerweile widerlegt.
Äußere Faktoren
Die wichtigsten äußeren Auslöser eines dyshidrotischen Ekzems sind Allergene, beispielsweise Nickel, und reizende Substanzen wie Säuren oder Laugen. Interessant: Dyshidrotische Ekzeme treten häufiger im Frühjahr und Sommer auf.
Weitere äußere Risikofaktoren sind übermäßiges Händewaschen sowie die Anwendung aggressiver Seifen. Durch diese Faktoren wird die Barrierefunktion der Haut gestört, wodurch sie anfälliger für Irritationen wird. Übermäßige Feuchtigkeit, zum Beispiel durch das lange Tragen von Einmalhandschuhen, weicht die Haut auf und stört ebenfalls die Barrierefunktion.
Innere Faktoren
Typische innere Faktoren, die das Risiko für ein dyshidrotisches Ekzem erhöhen, sind bestehende Unverträglichkeiten und Allergien oder eine erbliche Neigung zur Entwicklung von Allergien (Atopie). Das dyshidrotische Ekzem steht nach aktuellem Kenntnisstand häufig im Zusammenhang mit Vorgängen, die auch bei einer allergischen Reaktion ablaufen, und kann daher durch allergische Reaktionen begünstigt werden. Insbesondere sogenannte Kontaktallergien (Typ IV-Allergien) können bekanntermaßen ein dyshidrotisches Ekzem auslösen. Dazu zählen unter anderem Allergien gegen Duftstoffe, bestimmte Inhaltsstoffe in Kosmetikartikeln oder gegen die Metalle Nickel und Kobalt.
Des Weiteren sind Pilzinfektionen der Haut und eine übersteigerte Schweißproduktion (Hyperhidrose) an den Händen Risikofaktoren, da sie die Schutzfunktion der Haut schwächen, die Haut reizen und so die Entzündungsreaktion beim dyshidrotischen Ekzem fördern können. Außerdem erhöhen psychischer Stress und Rauchen mitunter das Erkrankungsrisiko. Ob hormonelle oder genetische Einflüsse eine Rolle spielen, ist Gegenstand aktueller Forschung. Das dyshidrotische Ekzem tritt bei Frauen aber ungefähr 4-mal häufiger auf als bei Männern.
Diagnose
Bei Verdacht auf ein dyshidrotisches Ekzem sollten Sie die Hautveränderungen dem Haus- oder Hautarzt zeigen.
Der Arzt wird Sie folgendes fragen:
- wann Ihre Beschwerden aufgetreten sind
- ob sich das Ekzem mit der Zeit verändert hat
- ob Sie einen konkreten Auslöser benennen können
- ob Sie solche Symptome bereits in der Vergangenheit hatten
- ob Vorerkrankungen wie Neurodermitis bestehen
- ob Sie Medikamente einnehmen.
Anschließend wird der Arzt das Ekzem anschauen. Dabei achtet er besonders darauf, welche Hautstellen genau betroffen sind, wie die Haut beschaffen ist und ob es Anzeichen für eine Infektion der Haut wie Eiter gibt.
Die Diagnose ist eine Blickdiagnose, das bedeutet, dass der Arzt die Diagnose durch die Betrachtung des Ekzems und das Patientengespräch stellen kann. Weitere Untersuchungsmethoden wie Blutuntersuchungen oder Gewebeentnahmen an den betroffenen Hautstellen sind in der Regel nicht erforderlich.
Abgrenzung zu anderen Hauterkrankungen
Das dyshidrotische Ekzem kann je nach Schweregrad und individueller Ausprägung ähnliche Symptome wie bestimmte andere Erkrankungen der Haut aufweisen:
- Pustulosis palmoplantaris verursacht ebenfalls Bläschenbildung, rissige Haut und Rötung an den Handinnenflächen und Fußsohlen. Die Bläschen heilen unter der Bildung von braunem Schorf ab. Diese Erkrankung wird als eine spezielle Ausprägung der Schuppenflechte (Psoriasis) angesehen. Ein Unterscheidungsmerkmal zum dyshidrotischen Ekzem ist deshalb eine bestehende Schuppenflechte.
- Pilzinfektionen der Haut sind ein häufiger Grund für ausgeprägten Juckreiz und können auch an Händen oder Füßen auftreten. Sie betreffen eher die Finger- oder Zehenzwischenräume. Im Unterschied zum dyshidrotischen Ekzem entstehen bei Pilzinfektionen aber in der Regel keine prall gefüllten Blasen.
- Eine akute Nesselsucht (Urtikaria) im Rahmen einer allergischen Reaktion beziehungsweise eine allergische Kontaktdermatitis können zu schmerzenden oder juckenden, geröteten Quaddeln führen. Bei der Nesselsucht ist meist ein eindeutiger Auslöser vorhanden, beispielsweise Gewürze, Kälte oder allergieauslösende Medikamente. Diese Erkrankungen können während symptomfreien Intervallen mit einem Allergietest diagnostiziert werden und bessern sich im Gegensatz zum dyshidrotischen Ekzem bei Anwendung von antiallergischen Medikamenten.
- Bei der atopischen Dermatitis (Neurodermitis) sind meist noch andere nahe Verwandte von ähnlichen Symptomen (z.B. Asthma oder Heuschnupfen) betroffen. Außerdem liegen oftmals keine prallen Bläschen, sondern kleine Beulen (Papeln) oder lediglich Hautrötungen vor.
- Eine Reihe seltener, blasenbildender Hauterkrankungen wie Epidermolysis bullosa simplex, Pemphigus vulgaris oder Impetigo bullosa können Ähnlichkeiten mit dem dyshidrotischen Ekzem aufweisen. Die Blasen bei diesen Erkrankungen sind oft relativ empfindlich gegenüber mechanischer Belastung, trotzdem kann die Unterscheidung schwierig sein.
- Die Hand-Fuß-Mund-Krankheit ist eine hochansteckende Infektion mit Coxsackie A-Viren, bei der an Händen, Füßen und im Mundbereich fleckig-knotige Ausschläge und teilweise auch Bläschen entstehen. Zudem bilden sich häufig schmerzende Bläschen an der Mundschleimhaut (Aphthen). Eine Unterscheidung zum dyshidrotischen Ekzem ist daher am Aussehen der Ausschläge und den Begleitsymptomen möglich.
- Im zweiten Stadium einer Syphilis-Infektion sind ebenfalls Ausschläge möglich, die einem dyshidrotischen Ekzem ähneln können. Das Aussehen dieser Ausschläge ist sehr variabel, daher sollte bei Verdacht auf eine zugrundeliegende Syphilis eine Blutuntersuchung erfolgen.
Behandlung
Die Behandlung eines akuten dyshidrotischen Ekzems erfolgt mit Medikamenten sowie mit nicht-medikamentösen Maßnahmen. Wenn ein konkreter Auslöser bekannt ist oder vermutet wird, sollte er in bestimmten Fällen zusätzlich behandelt werden, beispielsweise eine Pilzinfektion oder eine übermäßige Schweißproduktion. Wenn sich das Ekzem infiziert hat, muss auch diese Infektion mitbehandelt werden.
Nicht-medikamentöse Behandlung
-
-
Falls ein Auslöser bekannt ist, ist die wichtigste nicht-medikamentöse Maßnahme die Vermeidung des Auslösers, also zum Beispiel der Verzicht auf nickelhaltigen Schmuck bei einer Nickelallergie. Auch ein möglichst kompletter Rauchverzicht ist empfehlenswert.
-
-
Milde Basispflegecremes oder -lotionen können zur Linderung der Beschwerden beitragen. Zur Hautreinigung sollten Betroffene nur milde Reinigungsprodukte wie Waschlotionen mit hautneutralem pH-Wert anwenden. Übermäßig häufiges Waschen der betroffenen Stellen oder heißes Wasser führt zu einer weiteren Reizung und sollte unterlassen werden.
-
-
Präparate mit Teebaumöl wirken bei einem Teil der Patienten beruhigend auf die Haut und können die Abheilung fördern, beispielsweise in Form von Cremes oder Bädern.
-
-
Kalte oder feuchte Umschläge können zwar teilweise Juckreiz oder Schmerzen lindern. Allerdings wird so auch ein Aufquellen der oberen Hautschichten gefördert, wodurch die Haut weiter gereizt wird.
-
-
Die Anwendung von Bestrahlungs- beziehungsweise Lichttherapien ohne vorherige Rücksprache sollte unterbleiben. Bei falscher Verwendung von UV-Lampen kann die Haut geschädigt werden. Es gibt jedoch die Möglichkeit einer sogenannten PUVA-Therapie, bei der die Haut mit dem Wirkstoff Psoralen, der auch in ätherischen Ölen vorkommt, behandelt und mit UV-Licht bestrahlt wird. Um Verbrennungen zu vermeiden und die Gefahr von Folgeschäden wie Hautkrebs so gering wie möglich zu halten, sollte der Einsatz einer PUVA-Therapie zuvor mit einem Arzt besprochen werden.
-
-
Eine Leitungswasser-Iontophorese kann in manchen Fällen ebenfalls zur Therapie eingesetzt werden, vor allem zur Behandlung von übermäßigem Schwitzen. Hierbei werden die betroffenen Hautbereiche über mehrere Wochen täglich für 30 Minuten in einem Leitungswasserbad mit schwachem Gleich- oder Pulsstrom behandelt, was zu einer Minderung der Schweißproduktion führt. Bei korrekter Anwendung ist die Behandlung völlig ungefährlich und schmerzfrei.
Medikamentöse Behandlung
Zur medikamentösen Behandlung des dyshidrotischen Ekzems stehen verschiedene Arzneimittel zur Verfügung. Die Wahl sowie die Anwendung von Medikamenten sollten unbedingt vorab mit einem Mediziner besprochen werden. Ihr Arzt kann eine für Ihre Lebenssituation am besten geeignete Behandlung empfehlen.
Wenn Sie unter einem Ekzem leiden, können Sie bei ZAVA schnelle medizinische Hilfe erhalten – und das mit nur wenigen Klicks. Füllen Sie dazu unseren kurzen medizinischen Fragebogen aus und laden Sie dabei 2 Fotos von Ihrem Ekzem hoch. Einer unserer Ärzte wird Ihre Anfrage in Kürze bearbeiten. Eignet sich das ausgewählte Präparat bei Ihnen, können Sie es entweder in einer Apotheke vor Ort abholen oder zu sich nach Hause schicken lassen.
Zur Auswahl stehen diese Ekzem-Medikamente:
ab 15.52 €
ab 13.21 €
ab 14.74 €
ab 22.13 €
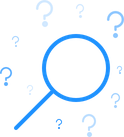
Keine Resultate gefunden.
Bitte überprüfen Sie Ihren Suchbegriff oder versuchen sie einen anderen Medikamentennamen.
-
-
Der wichtigste Baustein bei der medikamentösen Behandlung eines akuten dyshidrotischen Ekzems sind Cremes und Salben mit Kortikosteroiden wie Prednisolon, die im Volksmund oft als Kortison-Präparate bezeichnet werden und bis zu 2-mal täglich angewendet werden. Bei schweren Fällen (also bei Pompholyx), ist teilweise auch eine innerliche Anwendung von Kortikosteroiden nötig.
-
-
Zudem wird Alitretinoin zur Behandlung des dyshidrotischen Ekzems verwendet. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Retinoid, das mit Vitamin A verwandt ist und unter anderem entzündungshemmend wirkt.
-
-
Auch diverse Wirkstoffe, die immununterdrückend oder -verändernd wirken (Immunsuppressiva und Immunmodulatoren), können prinzipiell gegen das dyshidrotische Ekzem eingesetzt werden.
-
-
Zur Behandlung einer vorhandenen Überproduktion von Schweiß kann eine Injektion von Botulinumtoxin A (Botox) an den betroffenen Stellen erwogen werden.
-
-
Bei einer Infektion des Ekzems mit Bakterien oder Pilzen müssen gegebenenfalls Antibiotika oder Antimykotika (Antipilzmittel) eingesetzt werden.
-
-
Antihistaminika (Antiallergiemittel) helfen im Fall des dyshidrotischen Ekzems zwar weder gegen die sichtbaren Hautveränderungen noch gegen den Juckreiz, jedoch haben insbesondere Antihistaminika der 1. Generation wie Dimetinden eine zusätzliche sedierende (schläfrig machende) Wirkung, durch die manche Patienten die Beschwerden besser aushalten können. Wichtig: Die Einnahme sedierender Antihistaminika kann Ihre Fahrtüchtigkeit einschränken. Nehmen Sie diese Arzneimittel daher nicht ein, wenn Sie am Straßenverkehr teilnehmen müssen oder beruflich bedingt Maschinen bedienen.
Vorbeugung
Zur Vorbeugung und zur Verhinderung eines erneuten dyshidrotischen Ekzems sind vor allem allgemeine Maßnahmen der Hautpflege wichtig.
- Achten Sie auf die Verwendung milder Wasch- und Pflegeprodukte, also Waschlotionen und Handwaschmittel mit hautneutralem pH-Wert.
- Vermeiden Sie zu häufiges Händewaschen sowie den Einsatz stark entfettender Seifen und heißen Wassers.
- Die Anwendung von Feuchtigkeitscremes, Pflegeölen oder -cremes nach dem Händewaschen oder Duschen hilft dabei, die Haut vor Austrocknung zu schützen und ihre Barrierefunktion intakt zu halten.
- Wenn Sie an den betroffenen Stellen stark schwitzen, sollten Sie die Haut regelmäßig mit einem Baumwolltuch sanft abtrocknen, um ein Aufweichen der Haut durch den Schweiß zu verhindern. Zusätzlich können aluminiumhaltige Sprays oder Salben dabei helfen, das Schwitzen zu reduzieren. Eine weitere, aber relativ aufwendige Vorbeugung ist die Behandlung des Schwitzens mittels Iontophorese. Dabei wird die Haut über mehrere Wochen täglich für 30 Minuten in einem Leitungswasserbad elektrischem Strom ausgesetzt, wodurch die Schweißproduktion reduziert wird.
- Auch die Vermeidung längerer Duschzeiten von über 15 Minuten kann vorbeugend wirken.
- Sie sollten möglichst vollständig auf Rauchen verzichten.
- Bei manchen Patienten kann Stress die Entstehung des dyshidrotischen Ekzems begünstigen. Es ist dann empfehlenswert, Stress bewusst zu reduzieren und Entspannungstechniken wie Yoga oder autogenes Training zu erlernen beziehungsweise regelmäßig anzuwenden.
- Wenn das dyshidrotische Ekzem bei Ihnen häufig wiederkehrt, sollten Sie mit Ihrem Hautarzt die Möglichkeit einer medikamentösen Prophylaxe besprechen. Es gibt keine einheitliche Empfehlung für eine medikamentöse Prophylaxe für alle Patienten, daher sollten individuelle Lösungen erwogen werden.
Häufig gestellte Fragen
Ist ein dyshidrotisches Ekzem ansteckend?
Nein, das dishydrotische Ekzem ist keine ansteckende Erkrankung, sondern eine Reaktion der Haut auf den Kontakt mit bestimmten allergischen oder giftigen Stoffen.

Dr. med. Ulrike Thieme ist Medizinische Leiterin bei ZAVA und seit 2018 Teil des Ärzteteams. Ihre Facharztweiterbildung im Bereich Neurologie schloss sie 2018 ab. Vor ihrer Tätigkeit bei ZAVA arbeitete Dr. med. Ulrike Thieme an einem klinischen Forschungsprojekt über neurodegenerative Erkrankungen am National Hospital for Neurology and Neurosurgery, London.
Lernen Sie unsere Ärzte kennenLetzte Änderung: 23 Jun 2022
-
Fritsch, P., & Schwarz, T. (2018). Dermatologie Venerologie: Grundlagen. Klinik. Atlas. Springer-Verlag.
-
Plewig, G., Ruzicka, T., Kaufmann, R., & Hertl, M. (Eds.). (2018). Braun-Falco’s Dermatologie, Venerologie und Allergologie. Springer-Verlag.
-
Leung, A. K., Barankin, B., & Hon, K. L. (2014). Dyshidrotic eczema.
-
Abeck, D. (2010). Häufige Hautkrankheiten in der Allgemeinmedizin. Steinkopff.