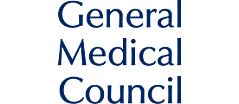Sodbrennen
Erhalten Sie Ihr Medikament gegen Sodbrennen direkt per Post nach Hause oder holen Sie es in einer Apotheke in Ihrer Nähe ab
Preis ab 13.04 € + Behandlungsgebühr 14.99 €
Einer unserer Ärzte wird Ihre Anfrage auswerten und falls angemessen ein Rezept ausstellen. Wie funktioniert ZAVA?
Unter Sodbrennen versteht man ganz allgemein brennende Schmerzen hinter dem Brustbein, genauer gesagt im Bereich der Speiseröhre. In westlichen Ländern leiden bis zu 15 % der Bevölkerung an Sodbrennen. Neben einer möglichen Verminderung der Lebensqualität kann über längere Zeit unbehandeltes Sodbrennen auch Folgeschäden verursachen. Deshalb sollten einerseits die Ursachen des Sodbrennens ermittelt und andererseits das Sodbrennen selbst therapiert werden.
Sie leiden unter Sodbrennen? Die Ärzte von ZAVA beraten Sie zur erstmaligen Einnahme eines rezeptpflichtigen Medikaments und stellen bei Eignung ein Rezept aus.
Produkt suchen

Verfügbar. Preis ab 15.05 € + Behandlungsgebühr 14.99 €
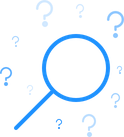
Keine Resultate gefunden.
Bitte überprüfen Sie Ihren Suchbegriff oder versuchen sie einen anderen Medikamentennamen.



Sodbrennen
-
-
Unter Sodbrennen versteht man ganz allgemein brennende Schmerzen hinter dem Brustbein, genauer gesagt im Bereich der Speiseröhre. In Industrieländern leiden bis zu 15 % der Bevölkerung an Sodbrennen. Neben einer möglichen Verminderung der Lebensqualität kann über längere Zeit unbehandeltes Sodbrennen auch Folgeschäden verursachen. Deshalb sollten einerseits das Sodbrennen therapiert werden und andererseits die Ursachen eines anhaltenden Sodbrennens ermittelt werden.
Wann es sinnvoll ist, einen Arzt aufzusuchen, und welche Möglichkeiten es gibt, um die Beschwerden zu lindern, erklärt Dr. med. Emily Wimmer, Ärztin bei ZAVA, in unserem Video zum Thema:
-
-
Sodbrennen kann durch mehrere Grunderkrankungen ausgelöst werden. Am häufigsten besteht eine Form der ösophagealen Refluxkrankheit (esophageal reflux disease, ERD).
Diese lässt sich nochmals unterteilen in die gastroösophageale Refluxkrankheit (GERD), sowie die nicht-erosive ösophageale Refluxkrankheit (NERD). Bei beiden Arten von ERD liegt eine Störung des Übergangs zwischen Speiseröhre (Ösophagus) und Magen vor. Dieser Übergang, der auch Ösophagussphinkter genannt wird, ist normalerweise geschlossen und wird nur beim Schlucken oder Aufstoßen kurzzeitig geöffnet. Bei den Refluxerkrankungen GERD und NERD allerdings ist der Verschluss entweder nicht mehr ausreichend stark oder auf andere Weise gestört, sodass Magensäure vom Magen in die Speiseröhre aufsteigen kann. Dort verätzt sie die Schleimhaut der Speiseröhre und verursacht so die typischen Schmerzen. Je nach Schwere des Sodbrennens kann die Magensäure auch bis in den Mund aufsteigen und dort ebenfalls Verätzungen hervorrufen. Der Unterschied zwischen GERD und NERD besteht darin, dass dieser Schaden nur bei GERD im Rahmen einer endoskopischen Untersuchung in der Speiseröhre an der Schleimhaut sichtbar sind.
-
-
Neben GERD und NERD gibt es noch das funktionelle Sodbrennen (functional heartburn, FH), bei dem kein Rückfluss von Magensäure existiert und auch keine anderen Ursachen nachgewiesen werden können. Davon abgegrenzt wird das Krankheitsbild der hypersensiblen Speiseröhre, bei der bereits normale Reize, wie die reguläre Nahrungsaufnahme ausreichen, um Sodbrennen zu verursachen.
Zusätzlich kann Sodbrennen auch noch andere Ursachen haben. Dazu zählen Störungen der Speiseröhrenbewegung (Motilitätsstörungen), vor allem beim Schlucken, oder das Festkleben von Tabletten in der Speiseröhre. Letzteres tritt vor allem bei bettlägerigen Menschen auf, die ihre Tabletten nur im Liegen zu sich nehmen können.
-
-
Wenn Sie nur an wenigen Tagen im Jahr unter Sodbrennen leiden, ist die Gefahr sehr gering, dass sich dadurch Folgeerkrankungen entwickeln. Je häufiger und stärker Ihre Beschwerden allerdings sind, desto eher kann das wiederholte Aufsteigen von Magensäure negative Langzeitfolgen haben. Möglich sind beispielsweise irreversible Schäden an den Zähnen, wenn die Magensäure häufiger bis in den Mund aufsteigt. Außerdem kann durch einen Verbindungsgang zwischen dem Nasenrachen und dem Mittelohr (eustachische Röhre) Magensäure ins Mittelohr gelangen und dort eine Mittelohrentzündung begünstigen.
Veränderungen der Schleimhaut in der Speiseröhre, die sogenannten Barrett-Metaplasie, sind eine typische Folge von langfristig unbehandeltem Sodbrennen. Im weiteren Verlauf besteht bei Barrett-Metaplasie die Gefahr, dass aus der veränderten Schleimhautstruktur Speiseröhrenkrebs entsteht.
-
-
Es gibt mehrere Einflüsse, die Sodbrennen unterstützen. Dazu zählen neben Alkoholkonsum und Rauchen auch einige Nahrungsmittel, insbesondere Pfefferminze, Knoblauch, Zitrusfrüchte und -säfte, Tomaten sowie Kaffee. Daneben erhöht der Genuss von fettreichen Mahlzeiten und großen Nahrungsmengen die Gefahr für Sodbrennen. Wenn Sie sich sofort nach dem Essen hinlegen oder in Kopftieflage schlafen, können Sie dadurch ebenfalls Sodbrennen auslösen. Als weitere Faktoren sind noch diverse Medikamente und eine Schwangerschaft zu nennen.
-
-
Sodbrennen wird durch fettige und saure Speisen und Getränke begünstigt. Bei Verzicht auf solche Nahrungsmittel kann insbesondere bei leichten Beschwerden bereits eine deutliche Besserung eintreten. Ebenso hilft der Verzicht auf Alkohol und Rauchen, Sodbrennen zu reduzieren. Auch Stressreduktion, sowie ein regelmäßiger Tagesablauf mit ausreichend Schlaf hat einen positiven Einfluss auf Sodbrennen.
Um das Aufsteigen von Magensäure in der Nacht zu verhindern oder zumindest zu erschweren, empfiehlt es sich, den Kopf beim Schlafen hoch zu lagern, beispielsweise durch Rückenlage mit einem zusätzlichen Kopfkissen. Diese Maßnahmen lindern die Beschwerden bei einem überwiegenden Teil der Patienten mit Sodbrennen und reichen bei leichten Fällen häufig bereits aus, um eine vollständige Heilung herbeizuführen.
-
-
Es gibt drei gängige Klassen von Medikamenten gegen Sodbrennen: Säurehemmer (Antazida), H2-Rezeptorantagonisten (H2RA) und Protonenpumpeninhibitoren (PPI). Diese drei Wirkstoffklassen unterscheiden sich in ihren Wirkmechanismen, ihrer Verträglichkeit und ihrer Wirksamkeit. Während Antazida heutzutage lediglich noch zur Selbstmedikation, beispielsweise nach einer großen, fettreichen Mahlzeit, zum Einsatz kommen, werden H2-Rezeptorantagonisten noch immer relativ häufig vor allem bei anhaltenden mittelschweren Beschwerden eingesetzt. Am effektivsten bei gleichzeitig wenigen Nebenwirkungen sind allerdings Protonenpumpeninhibitoren. Sie stellen die erste Wahl bei häufigem Sodbrennen dar und können in den meisten Fällen auch als Langzeittherapie sowie zur Prophylaxe eingesetzt werden.
-
-
Falls die medikamentöse Therapie nicht den gewünschten Erfolg bringt oder aufgrund von Medikamentenunverträglichkeit abgebrochen werden muss, hängt die weitere Behandlung von der Grunderkrankung ab. In der Regel werden bei einer unklaren Ursache spezielle diagnostische Methoden durchgeführt, insbesondere eine Endoskopie sowie weitere Untersuchungen. Wenn dabei die Ursache des Sodbrennens gefunden wird, kann eine entsprechende Therapie eingeleitet werden. Nur in besonders schweren Fällen sollte auch eine Operation in Betracht gezogen werden, bei der ein Band um das untere Ende der Speiseröhre gelegt wird, welches das Aufsteigen von Magensäure verhindert. Falls keine Ursache ausgemacht werden kann, muss nochmals die Vermeidung von Risikofaktoren wie Alkohol, Rauchen, fettigem Essen und Stress überprüft werden. Auch eine Behandlung mit Melatonin oder bestimmten neuromodulierenden Medikamenten kann zur Linderung führen.
-
-
Antazida bestehen in der Regel aus Magnesium-, Aluminium- oder Calcium-Salzen. Sie werden rezeptfrei in der Apotheke verkauft und sind unter verschiedenen Handelsnamen erhältlich. Sie neutralisieren die Magensäure und verhindern so, dass die Speiseröhre durch die Säure verätzt wird. Antazida können kurzfristig bei Bedarf genommen werden, sind aber für eine Dauertherapie und bei schweren Fällen von Sodbrennen ungeeignet.
-
-
Auch die Verwendung von H2-Rezeptorantagonisten ist heutzutage nur noch bei leichtem oder therapieresistenten Sodbrennen als Zusatztherapie angeraten. Zu den prominentesten Vertretern dieser Medikamentenklasse gehören die Wirkstoffe Cimetidin, Ramitidin und Famotidin. Im Gegensatz zu Antazida können sie zwar zur Langzeittherapie verwendet werden, durch die Entdeckung der Protonenpumpeninhibitoren hat die Bedeutung der H2-Rezeptorantagonisten in den letzten Jahren insgesamt aber abgenommen, da sie, bei geringere Wirksamkeit, häufiger Nebenwirkungen haben.
-
-
Protonenpumpeninhibitoren (PPI) wie beispielsweise Omeprazol, Pantoprazol (Pantozol®) und Esomeprazol (Nexium® mups) sind momentan der Goldstandard gegen Sodbrennen, insbesondere bei schweren Fällen. Neben Heilungsraten von 90 Prozent eignen sich PPI auch für Langzeittherapien mit Standarddosen zwischen 10 mg und 40 mg pro Tag sowie zur Prophylaxe nach einer Akutbehandlung. Es gibt keine nennenswerten Unterschiede in der Wirksamkeit zwischen den verschiedenen erhältlichen PPI, jedoch im Nebenwirkungsprofil.
-
-
Antazida sind im Allgemeinen sehr gut verträglich. Häufigste Nebenwirkungen sind, je nach Präparat, Verstopfungen oder Durchfall. Außerdem sollten Patienten, die unter eingeschränkter Nierenfunktion leiden, auf Antazida verzichten, da ansonsten deren Ausscheidung beeinträchtigt sein kann. Weiterhin stören Antazida die Aufnahme von Eisen und Phosphat aus der Nahrung. Bei Menschen, die unter Eisen- oder Phosphatmangel leiden, kann die längerfristige Einnahme von Antazida daher den jeweiligen Mangel verschlimmern.
Die Einnahme von Antazida kann außerdem zur Aufnahme und Ablagerung von Aluminium in Knochen und im Gehirn führen. Diese Ablagerungen können vor allem bei längerfristiger Einnahme zu Knochenerweichung oder nichtentzündlichen Veränderungen im Gehirn führen. Auch wenn noch nicht abschließend geklärt ist, ob diese Veränderungen schädlich sind, sollten Antazida daher nur als kurzzeitige Behandlung eingesetzt, und bei länger anhaltenden oder starken Beschwerden, durch H2-Rezeptorantagonisten oder Protonenpumpeninhibitoren ersetzt werden.
Antazida können auch die Aufnahme von anderen Medikamenten im Magen-Darm-Trakt behindern. Dazu zählen insbesondere manche Antibiotika, bestimmte Präparate zur Blutverdünnung, herzwirksame Glykoside und einige Medikamente zur Therapie von Gallensteinen. Halten Sie daher im Zweifel zunächst Rücksprache mit Ihrem Arzt, falls Sie weitere Medikamente einnehmen.
-
-
Durch die Einnahme von H2-Rezeptorantagonisten kann es zu Kopfschmerzen, Ausschlägen, Durchfall, Vergrößerung der Brustdrüsen beim Mann, Potenzstörungen, sowie Veränderungen des Blutbildes kommen. Zudem kann es bei Patienten, die unter eingeschränkter Leber- oder Nierenfunktion leiden, zu Verwirrtheit kommen.
H2-Rezeptorantagonisten können außerdem die Blutkonzentration diverser Medikamente sowie von Alkohol erhöhen. Daher sollten Sie während der Therapie mit H2-Rezeptorantagonisten keinen Alkohol zu sich nehmen.
-
-
Nebenwirkungen von PPI sind vor allem Kopfschmerzen, Schwindel und allergische Reaktionen. Außerdem können besonders bei Langzeitbehandlungen bakterielle Infektionen des Magens sowie ein erhöhtes Risiko für Frakturen auftreten. Daneben sollten bei längerer Behandlung die Vitamin B12-, Eisen-, Calcium- und Magnesiumspiegel regelmäßig kontrolliert werden. Bei der Einnahme weiterer Medikamente muss auf Wechselwirkungen mit den PPI geachtet werden. Für Schwangere und Stillende sind PPI generell nicht geeignet.
-
-
Neben den typischen Risiken einer Operation, beispielsweise durch die Vollnarkose, ergeben sich bei einer chirurgischen Behandlung von Sodbrennen je nach Ursache des Sodbrennens und nach verwendeter Operationsmethode sehr unterschiedliche spezifische Risiken, die Sie in solch einem Fall am besten ausführlich mit Ihrem Arzt und behandelnden Operateur besprechen.

Maike Michel unterstützt das Ärzteteam von ZAVA bei der medizinischen Texterstellung und -prüfung. Sie studierte Medizin an den Universitäten in Münster und Freiburg. Seit 2016 arbeitet sie als Assistenzärztin in einer psychiatrischen Klinik in Deutschland und trägt seit Juli 2022 den Facharzttitel für Psychiatrie und Psychotherapie.
Lernen Sie unsere Ärzte kennenLetzte Änderung: 08 Jun 2019
-
McCoul, E. D., Goldstein, N. A., Koliskor, B., Weedon, J., Jackson, A., & Goldsmith, A. J. (2011). A prospective study of the effect of gastroesophageal reflux disease treatment on children with otitis media. Archives of Otolaryngology–Head & Neck Surgery, 137(1), 35-41.
-
Moore, M., Afaneh, C., Benhuri, D., Antonacci, C., Abelson, J., & Zarnegar, R. (2016). Gastroesophageal reflux disease: A review of surgical decision making. World journal of gastrointestinal surgery, 8(1), 77.
-
Iwakiri, K., Kinoshita, Y., Habu, Y., Oshima, T., Manabe, N., Fujiwara, Y., ... & Ashida, K. (2016). Evidence-based clinical practice guidelines for gastroesophageal reflux disease 2015. Journal of Gastroenterology, 51(8), 751-767.
-
Hachem, C., & Shaheen, N. J. (2016). Diagnosis and Management of Functional Heartburn. The American journal of gastroenterology, 111(1), 53-61.
-
Katz, P. O., Gerson, L. B., & Vela, M. F. (2013). Guidelines for the diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease. The American journal of gastroenterology, 108(3), 308.
Medikamente gegen Sodbrennen