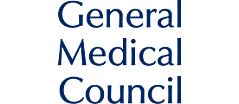Migräne

Medizinisch geprüft von
Dr. Nadia SchendzielorzLetzte Änderung: 02 Jul 2020
Migräne ist eine sehr verbreitete Form der Kopfschmerzen, die zusammen mit Begleiterscheinungen wie z. B. Appetitlosigkeit, Übelkeit und Licht- und Geräuschempfindlichkeit auftritt. Die Beschwerden können über mehrere Stunden und in Sonderfällen bis zu Tagen anhalten. Zur Behandlung werden unter anderem als Medikament Triptane eingesetzt, da sie eine schnelle Wirkung zeigen.

Kurzübersicht
Definition: Migräne ist eine Form von Kopfschmerzen, die immer wieder auftreten kann, meist einseitig verläuft und mit bestimmten Begleitsymptomen wie Übelkeit, Sehstörungen oder Lichtempfindlichkeit einher geht.
Symptome: Das ausschlaggebende Symptom bei Migräne ist starker, stechend-pulsierender Kopfschmerz, der typischerweise nur einseitig auftritt und für mehrere Stunden anhält.
Ursachen: Die genauen Ursachen für Migräne sind unbekannt. Neben einer familiären Veranlagung werden Veränderungen in den Blutgefäßen des Kopfes, Entzündungen und eine gesteigerte Erregbarkeit von Nervenzellen in bestimmten Bereichen des Gehirns diskutiert.
Auslöser: Bekannte Auslöser von Migräneattacken sind: Stress, unregelmäßiger oder zu kurzer Schlaf, Zeitverschiebungen, z. B. nach Flugreisen, Alkohol und Rauchen, unzureichende Trinkmenge, Wetterumschwünge, Menstruation und hormonhaltige Medikamente wie die Pille oder bestimmte Lebensmittel wie Zitrusfrüchte und Schokolade.
Behandlung: Je nach Häufigkeit, Dauer und Schwere der Attacken stehen verschiedene Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung, beispielsweise Reizabschirmung und Bettruhe, Schmerzmittel wie Ibuprofen, Paracetamol, Diclofenac, Acetylsalicylsäure oder Triptane, Mittel gegen Übelkeit, beispielsweise Metoclopramid.
Vorbeugung: Lebensstiländerungen wie Stressreduktion und Ausdauersport, Entspannungstechniken wie Muskelrelaxation, Akupunktur, Medikamentöse Prophylaxe, unter anderem mit Metoprolol, Valproinsäure und Amitriptylin.
Manchmal sind Kopfschmerzen ein Anzeichen für einen Notfall. In den folgenden Fällen sollten Sie sofort einen Arzt aufsuchen oder die Notrufnummer (112) anrufen:
- Bei schlagartig auftretenden, extrem starken Kopfschmerzen
- Wenn zusätzlich zu den Kopfschmerzen Nackensteifigkeit, Übelkeit, Erbrechen oder epileptische Anfälle auftreten
- Bei gleichzeitigen Lähmungen, Bewusstseinsstörungen, Seh-, Hör- oder Sprachstörungen oder Verwirrtheit
- Wenn die Aurasymptome im Rahmen einer Migräne mit Aura länger als eine Stunde unverändert andauern.
- Wenn Sie starke, bohrende Schmerzen an einer Schläfe bzw. einem Auge haben und gleichzeitig eine harte Arterie im Schläfenbereich tasten können
Über Migräne
Migräne zählt zu den idiopathischen Kopfschmerzen. Es ist also eine Form von Kopfschmerzen, deren Ursachen noch nicht eindeutig geklärt sind. Nach den Spannungskopfschmerzen ist sie die zweithäufigste Kopfschmerzform und betrifft jährlich circa 21 Millionen Menschen in Deutschland. Frauen sind dreimal so häufig betroffen wie Männer.
Wie entsteht Migräne?
Die genaue Entstehung von Migränekopfschmerzen ist noch Gegenstand aktueller Forschung. Eine gängige Theorie geht davon aus, dass durch Einflüsse wie Stress und hormonelle Schwankungen bestimmte Nerven im Kopfbereich (trigeminale Nerven) sowie Zellen des Immunsystems angeregt werden. Dadurch werden Botenstoffe freigesetzt, die einerseits eine leichte Entzündungsreaktion im Gehirn und an den Hirnhäuten hervorrufen. Andererseits werden die Blutgefäße im Gehirn geweitet. Beides führt sowohl zu den Kopfschmerzen als auch zu den Begleitsymptomen der Migräne.
Andere Theorien gehen beispielsweise von einer genetischen Veranlagung oder einem Zusammenhang zwischen Migräne und einem Loch zwischen den Herzvorhöfen (persistierendes Foramen ovale) aus.
Wie äußert sich eine Migräne?
Bei einer Migräneattacke kommt es meist zu halbseitigen, intensiven, pulsierenden Kopfschmerzen, die bei 60 % der Patienten streng einseitig auftreten. Die Kopfschmerzen halten 4 bis 72 Stunden an.
-
-
Bei einem Drittel der Betroffenen kündigt sich eine Migräneattacke durch sogenannte Prodromalsymptome (Vorläufersymptome) an. Diese können schon mehrere Stunden vor der eigentlichen Migräneattacke auftreten. Am häufigsten treten dabei Erschöpfung, Stimmungsschwankungen und Symptome des Magen-Darm-Trakts wie Heißhunger, Appetitlosigkeit und Verdauungsbeschwerden auf. Auch vermehrtes Gähnen, vermehrter Durst und häufiges Wasserlassen sind klassische Prodromalsymptome.
Wie unterscheidet sich eine Migräne von Spannungskopfschmerz?
Spannungskopfschmerzen betreffen überwiegend beide Kopfhälften und werden von den Betroffenen oft als kontinuierlich, aber nicht pulsierend beschrieben. Zudem sind sie in der Regel deutlich weniger intensiv als Migränekopfschmerzen und von drückendem Charakter. Begleitsymptome wie Lichtempfindlichkeit und Übelkeit treten bei Spannungskopfschmerzen nur in äußerst seltenen Fällen auf.
Wer ist typischerweise von Migräne betroffen?
Migräne tritt am häufigsten bei Menschen zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr erstmalig auf und betrifft Frauen ungefähr 3mal so häufig wie Männer.
Migräne kann allerdings bereits im Kindesalter auftreten und äußert sich dann häufig auch durch Bauchschmerzen und Erbrechen. Bis zu 10 Prozent der Schulkinder erkranken an Migräne. Hierbei sind Mädchen häufiger betroffen als Jungen. Mit der Pubertät nimmt durch die hormonelle Umstellung die Häufigkeit von Migräne zu.
Bei älteren Menschen sinkt die Häufigkeit wieder ab. Studien aus den USA fanden zudem Hinweise, dass Migräne in Haushalten mit niedrigem Einkommen häufiger vorkommt.
Symptome und Verlauf
Migräne zeichnet sich durch einen pulsierenden, tiefsitzenden Kopfschmerz aus, der meist einseitig auftritt und mehrere Stunden anhält. Ein weiteres typisches Merkmal des Migränekopfschmerz ist die Verstärkung bei körperlicher Belastung. Dementsprechend verhalten sich die Betroffenen während einer Migräneattacke in der Regel ruhig und benötigen Reizabschirmung sowie idealerweise Bettruhe.
-
-
Stunden bis Tage vor dem Einsetzen des eigentlichen Migränekopfschmerzes erfährt die Mehrzahl der Patienten bereits Vorläufersymptome (Prodromalsymptome). Dazu zählen:
- Muskelverspannungen
- Stimmungsveränderungen, z.B. Reizbarkeit
- Verdauungsbeschwerden
- Heißhunger auf bestimmte Nahrungsmittel oder Appetitlosigkeit
- Erschöpfungsgefühl
- Vermehrtes Gähnen
- Verstärkter Durst und vermehrtes Wasserlassen
- Schwierigkeiten bei Tätigkeiten wie Lesen und Schreiben
-
-
An die Prodromalphase schließt sich bei etwa 15-30% der Migränepatienten eine sogenannte Aura an. Darunter versteht man eine Phase mit typischen akuten Symptomen, die sich über mindestens 5 Minuten entwickeln und höchstens 60 Minuten anhalten. Spätestens nach weiteren 60 Minuten tritt der Migränekopfschmerz ein. Typische Aurasymptome sind:
- visuelle Begleiterscheinungen wie Flackern, Flimmern oder Lichtblitze
- ausbreitende Sensibilitätsstörungen oder Missempfindungen wie Kribbeln
- Hör-, Sprech- oder Sprachstörungen bis hin zu vorübergehenden Lähmungen der Sprechmuskulatur
-
-
Im Anschluss an die Auraphase entsteht der typische pulsierende, meist einseitige Kopfschmerz der gewöhnlich 4 bis 72 Stunden mit variierender Intensität anhält und häufig begleitet wird von:
- Appetitlosigkeit
- Übelkeit
- Erbrechen
- Schmerzverstärkung durch körperliche Aktivität
- Lichtscheu
- leichtes Augentränen
- Lärmempfindlichkeit
- Überempfindlichkeit gegenüber bestimmten Gerüchen
-
-
Die Rückbildungsphase wird bei ungefähr 70 Prozent der Patienten von weiteren typischen Symptomen, den Postdromalsymptomen, begleitet. Am häufigsten sind dabei:
- Erschöpfung bei 72 Prozent der Betroffenen
- leichte Kopfschmerzen, die aber deutlich schwächer sind als während der Migräneattacke, bei 33 Prozent der Betroffenen
- Konzentrations-, Aufmerksamkeits- oder Wahrnehmungsstörungen bei 12 Prozent der Betroffenen
Postdromalsymptome dauern durchschnittlich ungefähr 24 Stunden an und klingen anschließend von alleine ab. Aufgrund der häufigen Erschöpfung haben Patienten in der Rückbildungsphase oft ein ausgeprägtes Ruhe- oder Schlafbedürfnis.
Migräne mit Aura

Lichtblitze, blinde Flecken, Flackern und Flimmern: Die Vorboten einer Migräne mit Aura. 5-60 Minuten später kommt es dann zu den Migränekopfschmerzen. An dieser Form der Migräne leidet mehr als jeder 3. Betroffene. Lernen Sie hier, welche Formen eine Migräne mit Aura annehmen kann, welche Komplikationen auftreten können und wann ein Arztbesuch ratsam ist.
Migräne bei Kindern

Bei Migräne sprechen Kinder oft vom „bösen Kopf”. Denn den Kleinen fehlen häufig noch die richtigen Ausdrücke, um ihre Symptome zu beschreiben. Zudem kann sich eine Migräne auch durch eher untypische Anzeichen wie Teilnahmslosigkeit, Müdigkeit, Blässe, Übelkeit oder Erbrechen äußern. Wie Sie eine Migräne bei Kindern richtig erkennen, welche Auslöser es gibt und wie sich die Behandlung gestaltet, erfahren Sie hier.
Migräne in der Schwangerschaft und Stillzeit

Eine Schwangerschaft ändert einiges – auch in Bezug auf die Migränetherapie! Denn manche Medikamente können dem ungeborenen Baby schaden und dürfen nicht bedenkenlos eingenommen werden. Lesen Sie hier, warum von einer medikamentösen Selbstbehandlung während der Schwangerschaft und Stillzeit abzuraten ist und wie Sie sich und Ihr Kind am besten schützen.
Wann zum Arzt?
Bei wiederkehrenden Migräneattacken, die mit den gleichen Symptomen auftreten, ist es nicht nötig, jedes Mal zum Arzt zu gehen. In den folgenden Situationen sollten Sie die Beschwerden jedoch ärztlich abklären lassen:
- Wenn Kopfschmerzen oder Migräneattacken bei Ihren Kindern auftreten
- Wenn Sie zum ersten Mal ein Migräneattacke haben
- Wenn bei Ihren Migräneattacken neue Symptome auftreten
- Wenn Ihre Migräne länger als 72 Stunden anhält
- Wenn Sie Kopfschmerzen entwickeln, nachdem Sie einen Schlag auf den Kopf bekommen haben
- Bei Kopfschmerzen, die immer häufiger oder immer stärker auftreten
- Wenn Sie wegen Kopfschmerzen mehr als 8 Mal im Monat Schmerzmittel einnehmen müssen
Hausarzt oder Spezialist
Patienten mit Migränekopfschmerzen sind sich häufig nicht sicher, welcher Arzt die beste Anlaufstelle für sie ist.
-
-
Ihr Hausarzt sollte bei Migräne der erste Ansprechpartner für Sie sein. Zum einen kann ein Hausarzt viele Kopfschmerzen gut einschätzen und sicher diagnostizieren, außerdem kennt er Sie am besten und kann Ihnen eine auf Sie abgestimmte Behandlung anbieten. Durch die zunehmende Verbreitung von telemedizinischen Angeboten kann auch ein Besuch beim Online-Arzt eine erste Anlaufstelle bei Migräne sein.
-
-
Der Neurologe ist ein Spezialist für alle Nervenkrankheiten und somit auch für Kopfschmerzen. Eine Überweisung zum Neurologen erhalten Sie von Ihrem Hausarzt, wenn bei Ihren Kopfschmerzen eine weitergehende Abklärung notwendig ist oder wenn beim Hausarzt keine eindeutige Diagnose Ihrer Kopfschmerzen gestellt werden kann. In diesem Fall kann der Neurologe weitere Untersuchungen durchführen.
-
-
Ärzte, die eine Weiterbildung in Schmerzmedizin besitzen, kümmern sich vor allem um Patienten, die mit ihren Schmerzen schon seit Jahren in Behandlung bei Hausärzten und Neurologen sind, aber trotzdem noch Beschwerden haben. Eine Überweisung zum Schmerztherapeuten kann sowohl vom Hausarzt als auch vom Neurologen ausgestellt werden.
Wann zum Notarzt
Migränekopfschmerzen und ähnliche Beschwerden sind zwar nur in seltenen Fällen ein Notfall, allerdings ist es wichtig, diese Fälle schnell zu erkennen. Rufen Sie in folgenden Situationen den Rettungsdienst unter der Telefonnummer 112 oder kontaktieren Sie unverzüglich einen Arzt:
- Wenn Ihre Migräneaura sich nach einer Stunde nicht zurückgebildet hat bzw. unvermindert anhält. Es könnte sich in diesem Fall um einen migränösen Infarkt handeln
- Wenn Sie bis zu einer Stunde nach einer Migräneattacke einen epileptischen Krampfanfall erleiden
- Beim schlagartigen Auftreten von stärksten vorstellbaren Kopfschmerzen (Vernichtungskopfschmerz)
- Wenn sich Lähmungen, Sprachstörungen oder Sinnesstörungen wie Seh-, Hör und Gleichgewichtsstörungen nicht wie bei einer Aura über wenige Minuten entwickeln, sondern schlagartig auftreten
- Wenn Sie einen starken, bohrenden Kopfschmerz über Ihrem Auge verspüren, der beim Kauen stärker wird – insbesondere, wenn gleichzeitig Sehstörungen auftreten. Diese Symptome können auf eine Riesenzellarteriitis hinweisen, die unverzüglich behandelt werden muss
Ursachen
Die genaue Entstehung von Migräne ist noch nicht lückenlos bekannt. Trotzdem sind einerseits Risikofaktoren und andererseits sogenannte Triggerfaktoren bekannt. Risikofaktoren erhöhen die Wahrscheinlichkeit, überhaupt an Migräne zu erkranken. Triggerfaktoren hingegen können konkrete Migräneattacken auslösen.
-
-
Man unterteilt die Migräne-Risikofaktoren in angeborene und erworbene Risikofaktoren. Bei den angeborenen Faktoren ist die genetische Vorbelastung ein wichtiger Faktor. Bei einer Mehrheit der Migräniker besteht eine familiäre Häufung von Kopfschmerz-Erkrankungen, es gibt aber nicht ein einziges Gen, durch das man zum Migräniker wird. Vielmehr spielen viele verschiedene Gene eine Rolle für das Risiko, an Migräne zu erkranken. Außerdem haben das Geschlecht, Alter und Begleiterkrankungen einen Einfluss auf Migräne. Meist tritt sie zusammen mit Depressionen, Angststörungen und bipolaren Erkrankungen auf.
-
-
Äußere Auslöser von Migräneattacken werden als Triggerfaktoren bezeichnet. Diese Trigger sind individuell unterschiedlich. Häufig werden Wetterveränderungen, Nahrungsmittel, Schlafprobleme, Stress und Hormonschwankungen von Migränepatienten genannt. Gerade Nahrungsmittel werden als Auslöser jedoch kontrovers diskutiert, da zu den vorausgehenden Symptomen auch Heißhunger auf Nahrungsmittel gehören kann. Dadurch können Patienten dieses Prodromalsymptom fälschlicherweise als Ursache einer Attacke wahrnehmen.
Diagnose
Die korrekte Diagnose der Kopfschmerzart ist wichtig, um die bestmögliche Behandlung auswählen zu können. In der Mehrzahl der Fälle kann die Diagnose aber bereits durch ein Gespräch und einfache Untersuchungen gestellt werden. Weitergehende Untersuchungen sind nur in relativ seltenen Fällen notwendig.
Patientengespräch (Erhebung der Krankheitsgeschichte)
Im Patientengespräch fragt der Arzt zunächst nach der Häufigkeit und Dauer der Kopfschmerzen. Auch der genaue Ort der Schmerzen und die Schmerzqualität, also die Art der Schmerzen, werden erfragt. Der Arzt wird außerdem von Ihnen wissen wollen, ob Sie neben den reinen Schmerzen noch andere Krankheitszeichen bei sich festgestellt haben, beispielsweise Sehstörungen oder Schwindel. Daneben wird Sie der Arzt in der Regel zu Ihren Vorerkrankungen und zu regelmäßig eingenommenen Medikamenten befragen. Weitere Punkte können allgemeine Lebensumstände und Gewohnheiten wie Schlaf, Arbeitsbelastung oder Alkoholkonsum sein.
Körperliche Untersuchung (nicht immer notwendig)
Die körperliche Untersuchung richtet sich nach den Informationen, die Sie dem Arzt im Gespräch gegeben haben, daher werden nicht alle Untersuchungen bei allen Patienten durchgeführt. Häufig wird der Arzt aber die Augenbewegungen testen und die Muskulatur im Kopf- und Nackenbereich abtasten. Außerdem kann er durch gezielte Berührungen im Gesicht überprüfen, ob die Berührungsempfindung intakt ist. Weitere mögliche Untersuchungen sind Gleichgewichts- und Koordinationstests sowie die Untersuchung der Kraft und Reflexe in Armen und Beinen.
Weitere Untersuchungen
Weitere Untersuchungen sind nur notwendig, wenn die Diagnose nach Gespräch und körperlicher Untersuchung entweder noch nicht eindeutig ist, oder wenn die Kopfschmerzen aufgrund einer anderen Grunderkrankung auftreten (sekundäre Kopfschmerzen). Es gibt eine Vielzahl an möglichen weiteren Untersuchungen, die aber immer nur einen Teil der möglichen Diagnosen abdecken. Die am häufigsten eingesetzten Untersuchungen sind:
- Röntgen oder Computertomographie (CT) von Kopf und Wirbelsäule bei Verdacht auf eine Verletzung, einen Bandscheibenvorfall, eine Fehlstellung oder eine Hirnblutung
- Blutuntersuchung bei Verdacht auf einen Infekt oder eine internistische Erkrankung als Ursache der Kopfschmerzen, zum Beispiel Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus)
- MRT-Bildgebung (Kernspintomographie) bei Verdacht auf einen Tumor oder erhöhten Hirndruck
- Spezialisierte Fragebögen bei Verdacht auf Depression oder eine andere psychiatrische Erkrankung
- (Langzeit-)Blutdruckmessung bei Verdacht auf Blutdruckschwankungen
Kopfschmerztagebuch
Das Führen eines Kopfschmerztagebuchs ist für Patienten empfehlenswert, die unter anhaltenden oder immer wiederkehrenden Kopfschmerzen leiden. In einem Kopfschmerztagebuch schreiben Sie täglich auf, ob, wann und wie lange Sie an Kopfschmerzen litten. Auch der genaue Ort und die Art der Schmerzen sowie Begleitsymptome sollten beschrieben werden. Zudem wird im Kopfschmerztagebuch vermerkt, welche und wie viele Schmerzmittel Sie eingenommen haben beziehungsweise wie gut die Anwendung geholfen hat. Außerdem sollten Sie die Situation, in der die Kopfschmerzen aufgetreten sind, notieren. Aus den Einträgen können sowohl Sie als auch der Arzt dann leichter erkennen, wodurch die Kopfschmerzen eventuell ausgelöst werden, was für eine Diagnose vorliegt und ob die verwendeten Medikamente sinnvoll sind.
Ein Kopfschmerztagebuch zu führen, muss nicht kompliziert sein: Wenn Sie möchten, können Sie sich hier einen kostenfreien Vordruck für Ihr Symptomtagebuch herunterladen.
Behandlungsmöglichkeiten bei Migräne

Was tun, wenn der Kopf mal wieder pocht und hämmert? Eine Migräne ist zwar nicht heilbar, lässt sie sich heutzutage jedoch sehr gut behandeln. Wir haben hier für Sie alle wichtigen Informationen zu Dosierung, Darreichungsform und Anwendung der häufigsten bei Migräne eingesetzten Medikamente zusammengetragen.
Alternative Behandlungsmöglichkeiten bei Migräne

Migräne natürlich behandeln - geht das? Ja! Bei Migräne stehen verschiedene alternative Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die Wirksamkeit vieler dieser Präparate ist jedoch deutlich weniger belegt als die der klassischen Medikamente. Dennoch sind pflanzliche Heilmittel, Schüssler Salze & Co. bei vielen Menschen beliebt. Hier erfahren Sie, welche alternativen Behandlungen Ihnen helfen können, Ihre Migräne in den Griff zu bekommen.
Vorbeugung
Die Vorbeugung von Migränekopfschmerzen gelingt in vielen Fällen bereits durch einfache Maßnahmen. Häufig kann die Zahl der Attacken durch eine gute Vorbeugung deutlich reduziert werden.
-
-
Langanhaltender und intensiver Stress gilt als einer der Hauptauslöser von Migräneattacken. Achten Sie darauf, regelmäßige Ruhephasen einzulegen und sich Zeit für Entspannungsübungen zu nehmen. Auch die Lösung von zwischenmenschlichen Konflikten im privaten und beruflichen Bereich trägt zur Reduktion von Stress bei.
-
-
Auch in den beschwerdefreien Phasen sollten Sie auf regelmäßige Einschlafzeiten sowie eine Schlafdauer von 6-8 Stunden achten. Außerdem sind gute Schlafbedingungen wichtig, also zum Beispiel Ruhe und eine gute Luftqualität im Schlafzimmer. Sowohl Schlafmangel als auch häufige sehr lange Schlafdauern können Migräneattacken provozieren.
-
-
Bestimmte Nahrungsmittel stehen im Verdacht, Migräne auszulösen. Dazu zählen Zitrusfrüchte, Milchprodukte sowie Lebensmittel mit einem hohen Tyramin-Gehalt wie Schokolade und Rotwein. Achten Sie grundsätzlich auf eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst und Gemüse sowie wenig Alkohol. Wenn Sie den Verdacht haben, dass bestimmte Lebensmittel bei Ihnen Migräne auslösen, können Sie individuell versuchen, diese Lebensmittel zu meiden.
-
-
Bei einer unzureichenden Trinkmenge können Migräneattacken häufiger auftreten. Täglich sollten Sie zwischen 2 und 3 Liter an Flüssigkeit zu sich nehmen, bei sportlicher Aktivität oder sehr heißen Temperaturen auch mehr. Geeignete Getränke sind Wasser und ungesüßte Tees sowie in Maßen Fruchtsäfte. Auf größere Mengen Limonade und Softdrinks sollten Sie verzichten. Die Auswirkungen von Kaffee auf Migräne sind individuell unterschiedlich; sowohl eine Verbesserung als auch eine Verschlechterung der Symptome ist möglich.
-
-
Rauchen erhöht das Risiko für Migräneattacken bis auf das Zehnfache und stellt einen der wichtigsten Auslöser dar. Auch Alkohol ist ein bekannter Triggerfaktor von Migräneattacken. Die Häufigkeit von Migräneattacken kann also drastisch reduziert werden, indem Sie auf Alkohol und Rauchen möglichst komplett verzichten.
-
-
Während einer Migräneattacke verstärkt körperliche Aktivität die Beschwerden. Zwischen den Attacken ist regelmäßiger Ausdauersport aber eine gute Vorbeugung. Für eine effektive Vorbeugung sollten Sie 3 Mal pro Woche 1 Stunde Ausdauersport wie Schwimmen, Fahrradfahren oder Joggen machen. Alternativ kann auch strammes Spazierengehen vorbeugend wirken. Achten Sie dabei aber darauf, sich nicht vollkommen zu verausgaben, da ansonsten das Risiko für eine Migräneattacke durch körperliche Erschöpfung wieder steigt.
Häufig gestellte Fragen
Ist Migräne heilbar?
Migräne ist grundsätzlich eine chronische Erkrankung und kann immer wieder auftreten. Allerdings schaffen es viele Patienten, durch die Beachtung von vorbeugenden Maßnahmen ihr Leben frei von Migräneattacken zu bestreiten.
Migräne oder Schlaganfall?
Sowohl bei Migräne als auch bei einem Schlaganfall können Symptome wie Sehstörungen, Sprachstörungen oder halbseitige Lähmungen auftreten. Die Unterschiede können sehr subtil sein und sind für Laien häufig nicht sicher zu unterscheiden. Bei einem Schlaganfall treten die Symptome schlagartig auf, wohingegen sie sich bei einer Migräneaura über wenige Minuten schleichend entwickeln. Eine eindeutige Zuordnung kann nur durch bildgebende Untersuchungen wie eine Computertomographie oder ein MRT erfolgen.
Kann man auch Spannungskopfschmerzen und Migräne gleichzeitig haben?
Migräne und Spannungskopfschmerz können gleichzeitig auftreten. Beispielsweise können ein halbseitiger pochender Migräneschmerz und zusätzlich ein beidseitiger Druckkopfschmerz vorliegen. Beide Schmerzarten müssen dann mitunter getrennt behandelt werden.
Was ist das Locked-in-Syndrom?
Das locked-in-Syndrom bezeichnet einen Zustand, bei dem die Betroffenen zwar bei vollem Bewusstsein sind, aber mit Ausnahme der Augen keinen Körperteil bewegen können. Das locked-in-Syndrom ist selten und tritt meistens durch einen Verschluss der Basilar-Arterie am Hinterkopf, durch Hirntumore, Entzündungen des Gehirns oder Schädel-Hirn-Traumata auf. Außerdem existieren vereinzelte Berichte, bei denen eine Migräne vom Basilaristyp als Auslöser eines vorübergehenden locked-in-Zustands vermutet wurde.
Was ist menstruelle Migräne?
Menstruelle Migräne tritt im Rahmen der Regelblutung bei bis zu 20 % aller Frauen auf und äußert sich normalerweise als Migräne ohne Aura. Mögliche Begleitsymptome sind Stimmungsveränderungen, Ängstlichkeit, Schlafstörungen, Magen-Darm-Probleme und Abgeschlagenheit. Neben allgemeinen Maßnahmen zur Vorbeugung von Migräne ist eine spezifische Vorbeugung schwierig, da die menstruelle Migräne wahrscheinlich durch die Hormonschwankungen im Rahmen der Menstruation bestimmt wird.
Wie beeinflusst Koffein Migräneschmerz?
Koffein hat eine sehr individuelle Wirkung auf Migränekopfschmerzen. Bei manchen Patienten verstärkt Koffein die Symptomatik, während bei anderen Patienten die Schmerzen verringert werden. Eine allgemeingültige Empfehlung ist deshalb nicht möglich. Sie können aber selbst testen, ob Ihre Beschwerden durch das Weglassen von Kaffee seltener beziehungsweise schwächer werden.
Wie beeinflusst Schlaf Migräne?
Schlafmangel, unregelmäßige Schlafzeiten oder aber auch zu viel Schlaf sind mögliche Auslöser von Migräneattacken. Eine Schlafdauer von 6-8 Stunden sollte angepeilt werden, um Migräneattacken vorzubeugen.
Kopfschmerzen durch Bluthochdruck?
Bluthochdruck sollte immer behandelt werden und kann zur Entstehung von Kopfschmerzen beitragen. Der Einfluss von Bluthochdruck bei der Migräneentstehung ist nicht vollständig geklärt, allerdings ist bekannt, dass bestimmte Blutdrucksenker, sogenannte Betablocker, zur Behandlung von Migräne eingesetzt werden können.
Kopfschmerzen beim Fasten?
Fasten führt zu Stress für den Körper und ist ein nachgewiesender Auslöser von Migräneattacken.
Hilft Cola bei Kopfschmerzen?
Ähnlich wie bei Koffein kann auch Cola unterschiedliche Wirkungen haben. Bei manchen Patienten kann Cola lindernd auf Migräne wirken, indem es Flüssigkeitsverluste und eine Unterzuckerung ausgleicht. Bei anderen Patienten führt Cola durch das enthaltene Koffein zu einer Verstärkung der Migräne. Ob bei Ihnen Cola gegen Migräne hilft, müssen Sie also letztendlich selbst ausprobieren.

Dr. Nadia Schendzielorz war von 2016 bis 2020 Apothekerin bei ZAVA und unterstützt das Team nun freiberuflich bei der medizinischen Textprüfung. Sie schloss ihr Studium der Pharmazie an der Rheinischen-Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn ab. Im Anschluss arbeitete sie an ihrer Dissertation an der Universität von Helsinki in Finnland und promovierte erfolgreich im Fachbereich Pharmakologie.
Lernen Sie unsere Ärzte kennenLetzte Änderung: 02 Jul 2020
-
Baron, R., Koppert, W., Strumpf, M., & Willweber-Strumpf, A. (2019). Praktische Schmerzmedizin. Springer Berlin Heidelberg.
-
Göbel, H. (2012). Die Kopfschmerzen. Springer Berlin Heidelberg.
-
Dalkara, T., & Kılıç, K. (2013). How does fasting trigger migraine? A hypothesis. Current pain and headache reports, 17(10), 368, online: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23996724/, abgerufen am 05.05.2020.
-
Straube, A., & Ruscheweyh, R. (2019). Epidemiologie von Kopfschmerzen über die Lebensspanne. Nervenheilkunde, 38(10), 735-739, online: https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/a-0988-4322, abgerufen am 24. April 2021.
-
Ramachandran, R. (2018, May). Neurogenic inflammation and its role in migraine. In Seminars in immunopathology (Vol. 40, No. 3, pp. 301-314). Springer Berlin Heidelberg, online: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29568973/, abgerufen am 12.06.2020.